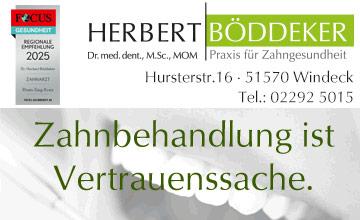Am 7. Juni 2025 unternahm der Männergesangverein Eintracht Leuscheid e.V. einen erlebnisreichen Tagesausflug ins westliche Rheinland – mit den geschichtsträchtigen Städten Aachen und Jülich als Ziel. Früh morgens um 07:00 Uhr startete die Reisegruppe am Treffpunkt „Lemo“ in Leuscheid.

Der Ausflug führte die Teilnehmer ins sogenannte „Indenland“, wo sie bei drei fachkundigen Führungen spannende Einblicke in die regionale Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten erhielten. Sowohl Aachen, bekannt als Krönungsort der deutschen Könige und Wirkungsstätte Karls des Großen, als auch die Festungsstadt Jülich mit ihrer Renaissance-Zitadelle, boten ein vielfältiges Programm.
Zum Abschluss des ereignisreichen Tages wurde gemeinsam ein köstliches Abendbuffet genossen, bevor es wieder zurück nach Leuscheid ging.
Ausflug zur Geschichte der Braunkohle im Rheinland
Unser Ausflug begann mit einer kleinen Enttäuschung: Der Indemann war leider geschlossen.
Dennoch hatten wir einen spannenden Tag und viele interessante Eindrücke – vor allem zum Thema Braunkohle und ihrer Bedeutung für das Rheinland.
Geologische Grundlagen
Im Geologieunterricht vor Ort erfuhren wir, dass das Rheinland vor rund 20 Millionen Jahren eine Sumpf- und Moorlandschaft war. Unter Luftabschluss wurden damals Pflanzenreste vergraben – manchmal auch tierische Überreste – und über Millionen Jahre hinweg zu Braunkohle umgewandelt. Dieser Prozess dauerte etwa 15 bis 50 Millionen Jahre. Steinkohle hingegen entstand schon vor rund 150 Millionen Jahren. Diamanten bestehen übrigens aus noch stärker verdichtetem Kohlenstoff.
Braunkohle – der Brennstoff aus dem Boden
Braunkohle enthält im rohen Zustand rund 65 % Wasser. Erst durch das Trocknen, etwa in Brikettfabriken (bis in die 1990er Jahre gebräuchlich), wurde sie als Brennstoff effektiv nutzbar. Viele Haushalte nutzten bis in die 1980er Jahre Kohleöfen. Erst ab Mitte der 80er Jahre erfolgte die Umstellung auf Erdgas – ein günstiger und reichlich vorhandener Energieträger.
Entstehung der Braunkohlenutzung im Rheinland
Obwohl die größten Braunkohlevorkommen in Leipzig und der Oberlausitz liegen (geschätzte 50 Milliarden Tonnen heute, früher sogar 65 Milliarden), war das Rheinland ein bedeutendes Revier – mit einer Fläche von nur 2.500 km2 das kleinste, aber eines der aktivsten. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann die Hauptnutzung der Braunkohle zur Stromerzeugung. Die BIAG (Braunkohlenindustrie AG) war ein wichtiger Akteur im Raum Aachen, mit dem Markenbegriff „Zukunft“. Passend dazu steht heute der Indemann auf der Goldsteinkuppe – einem rekultivierten Tagebau-Rest.
Stromerzeugung und Industrialisierung
Ein technischer Meilenstein war die Erfindung der Lichtmaschine durch Werner von Siemens im Jahr 1866 – die Voraussetzung für die Elektrifizierung und die Verstromung der Braunkohle. Die Kraftwerke wurden direkt an die Abbaugebiete gebaut, um lange Transportwege zu vermeiden – im Gegensatz zur Steinkohle, die sogar aus Australien importiert wurde. Der günstige Strom zog viele Industriebetriebe an – zuerst im Aachener Raum, dann in den südlichen und nördlichen Revieren:
- Nordrevier (z. B. Garzweiler, Grevenbroich): metallverarbeitende Industrie ab 1914
- Südrevier (Hürth – Brühl): chemische Industrie
- Westrevier: eine Mischung, vor allem Metallverarbeitung
Die Verfügbarkeit von Strom förderte nicht nur die Industrialisierung, sondern auch die Besiedlung der Region.
Der Tagebau Inden
Der Tagebau Zukunft wurde 1955 in Inden abgelöst. Im gleichen Jahr wurde auch der erste Braunkohle-
Kraftwerksblock in Weisweiler durch Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard in Betrieb genommen – mit damals erstaunlichen 100 Megawatt Leistung. Heute erreichen moderne Blöcke 600 bis 1.000 Megawatt. Insgesamt wurden fünf große Kraftwerke gebaut, um die gesamte Region mit Energie zu versorgen.
Zeitenwende – und viele offene Fragen
All das wird in Kürze Geschichte sein: Die Braunkohleverstromung wird nach und nach eingestellt. Doch wie es konkret weitergeht, konnte uns auch der Fremdenführer nicht sagen. Die Zukunft ist ungewiss –
vor allem im Hinblick auf die Versorgungssicherheit.
Er brachte es mit einem eindrücklichen Vergleich auf den Punkt: Die Energiewende gleiche einem Fallschirmsprung, bei dem der Springer erst nach dem Absprung anfängt, sich Gedanken über die
Landung zu machen – und sich im freien Fall den Fallschirm selbst zusammennähen muss. Denn weder die Speicherung des Stroms ist beim gleichzeitigen Ausstieg aus Kohle- und Kernenergie ausreichend gelöst noch die kritische Frage der Grundlastfähigkeit unseres Stromsystems – also der verlässlichen Versorgung rund um die Uhr, unabhängig von Sonne und Wind.
Besuch des Aachener Doms
Gegen 12 Uhr erreichten wir die Stadt Aachen. Ziel unseres Besuchs war der berühmte Aachener Dom – ein bedeutendes Bauwerk mit einer beeindruckenden Geschichte. Der Aachener Dom wurde im Jahr 1978
als erstes deutsches Bauwerk in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Sein Ursprung reicht bis in die
Zeit Karls des Großen zurück, der im 7. Jahrhundert regierte und den Bau der Pfalzkapelle, des heutigen Doms, veranlasste. Der Dom war über Jahrhunderte hinweg der Krönungsort deutscher Könige – insgesamt wurden hier 30 Herrscher gekrönt. Die Architektur des Doms ist geprägt von mehreren Epochen. Der ursprüngliche oktogonale Zentralbau stammt aus der karolingischen Zeit. Später kamen gotische Elemente im 14. und 15. Jahrhundert hinzu, barocke Erweiterungen folgten im 18. Jahrhundert. Der heutige sogenannte „Domhut“ im neugotischen Stil wurde Ende des 19. Jahrhunderts vollendet. Das Oktogon symbolisiert mit seiner achtseitigen Form die Zahl der Vollendung, der Harmonie und steht für den achten Tag – den Tag der Auferstehung und des Jüngsten Gerichts. Ein bedeutendes Geschenk ist die
Barbarossaleuchte, die einst von Kaiser Friedrich Barbarossa gestiftet wurde, als Karl der Große heiliggesprochen wurde. Auch heute noch spürt man die Verehrung für Karl – seine Gebeine ruhen im goldenen Karlsschrein, der an seine Größe erinnert: 1,84 Meter. Im Dom befindet sich außerdem der Marienschrein, in dem kostbare Reliquien aufbewahrt werden, darunter das Marientuch und das angebliche Lendentuch Jesu.
Alle sieben Jahre werden diese Schätze im Rahmen der Heiligtumsfahrt öffentlich gezeigt – ein Ereignis, das Pilger aus der ganzen Welt anzieht.
Aachen zählt neben Santiago de Compostela und Rom zu den wichtigsten Pilgerstätten des Mittelalters. Eindrucksvoll ist auch die enorme Fensterfläche von rund 1.000 Quadratmetern, die das Innere des Doms in farbenprächtiges Licht taucht. Der Dom steht an einem erdbebensicheren Ort und war zu Karls Zeiten der zentrale Ort in einer Stadt mit damals etwa 4.000 bis 5.000 Einwohnern.
Besuch der Zitadelle und des Brückenkopfs Jülich
Am späten Nachmittag zwischen 16:00–17:30 Uhr besuchten wir die Zitadelle und den Brückenkopf in
Jülich – eindrucksvolle Zeugnisse der Festungsarchitektur aus der Renaissancezeit.
Historischer Hintergrund
Bereits 1793/94 rückten französische Truppen über das Rheinland vor – im Rahmen ihrer Revolutionskriege. Die Zitadelle bei Jülich wurde als Festung in der Renaissance errichtet, mit dem Ziel,
den Zugang zum Rhein zu sichern. Das Gelände war sumpfig und bot nur eine einzige Furt zur Überquerung des Flusses – strategisch von höchster Bedeutung.
Militärische Architektur
Die Zitadelle ist 630 Meter lang und 300 Meter breit. Besonders beeindruckend war die Kronenbastion,
eine Verteidigungsform mit vollständiger Rundumverteidigung ohne tote Winkel. In der gesamten
Anlage wurde auf hohe Effizienz und Sicherheit geachtet:
- Pulvermagazin: Das Tonnengewölbe verfügte über ein ausgeklügeltes Lüftungssystem, um
Feuchtigkeit abzuleiten. Im Keller lagerte man Kohle, um Restfeuchtigkeit zu binden – so blieb
das Pulver trocken. Zur Vermeidung von Funkenflug wurden ausschließlich Kupferbeschläge
verwendet, Metallschuhe waren verboten. - Kasematten und Hohltraversen: Die bombensicheren Geschützstellungen befanden sich unter
Erddämmen mit tonhaltiger, wasserabweisender Deckschicht. Auch die Escarpenmauer – eine
mit Erde und Mauerwerk verstärkte Außenmauer – bot besonderen Schutz. - Abluftsystem: Für den Kanonenrauch gab es ein eigenes Verdampfungssystem, das die Sicht
während des Gefechts wiederherstellen sollte.
Leben und Leiden in der Festung
Nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten lebten innerhalb der Mauern. Verwundete starben selten direkt durch die Verletzung, sondern an deren Folgen – mangels hygienischer und medizinischer Versorgung. Bomben aus Eisen richteten oft nur bei direktem Treffer Schaden an; einige enthielten Nägel für eine verheerende Nachzündung.
Persönliche Geschichte
Erwähnt wurde auch ein Festungsbaumeister, der als Hauptmann tätig war und später als Bauunternehmer arbeitete. Er hatte 12 Nachkommen und wurde mit einer jungen Frau bekannt, die in
der Festung tätig war – eine berührende Anekdote aus einer ansonsten von Krieg geprägten Zeit.
Der Brückenkopf
Der sogenannte Brückenkopf diente als vorgelagerte Verteidigungsstellung. Die Indundationsfelder –
also gezielt geflutete Bereiche – sollten den Angreifer behindern. Die Franzosen unterschätzten jedoch,
dass ihre eigene Stellung dadurch ebenfalls unbrauchbar wurde. In den 1920er Jahren wurde das
Gelände um Über-Tingplätze erweitert – erhöhte Plattformen für Artillerie und Beobachtung.
Abschließender Eindruck
Der Besuch war äußerst informativ und hat verdeutlicht, wie ausgeklügelt und durchdacht die militärischen Bauwerke der Renaissancezeit waren – sowohl in ihrer Konstruktion als auch in
ihrer Funktion. Besonders faszinierend war die Verbindung von Architektur, Technik und Geschichte auf engstem Raum.
Abschluss des ereignisreichen Tages
Zum Abschluss des ereignisreichen Tages kehrten wir im Hotel Jufa ein, wo ein köstliches Abendbuffet auf uns wartete und wir in geselliger Runde beisammensaßen. Gut gesättigt traten wir gegen 19:00 Uhr die Heimreise an und kamen wohlbehalten in Leuscheid an.
(Text & Bild: MGV Eintracht Leuscheid e.V.)